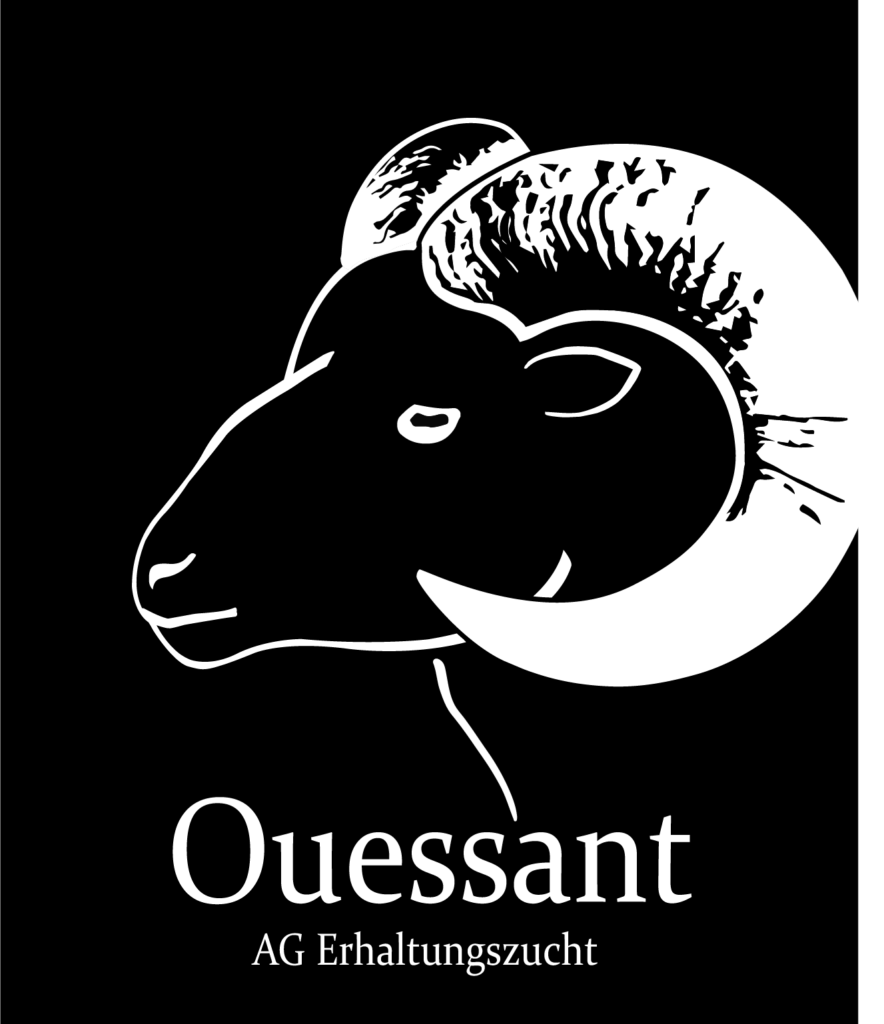Das Ouessantschaf – Einführung in die Geschichte einer alten bretonischen Landschafrasse.
Die Rasse Ouessant hat ihren Ursprung auf der gleichnamigen bretonischen Insel, die etwa 20 Kilometer vor der Küste des Départements Finistère im Atlantik liegt. An die Insel mit ihrer isolierten geographischen Lage, ihren spezifischen Umweltfaktoren und lokalen Haltungsanforderungen gebunden, erfüllte das Ouessantschaf im 19. Jahrhundert alle Kriterien einer Landrasse, die hervorragend an die Gegebenheiten ihres Ursprungsgebietes angepasst war. Die rauen Umweltbedingungen, insbesondere das im Winterhalbjahr sehr stürmische Meeresklima, aber auch das karge natürliche Futterangebot auf der baumlosen Insel dürften erheblich zum Kleinwuchs der Tiere beigetragen haben. Historisch sind gewundene Hörner bei den Böcken, hornlose Mutterschafe und Widerristhöhen von unter 50 cm belegt sowie ein dichtes Wollflies, das vor den starken Winden in Herbst und Winter schützte.
Bis in das späte 19. Jahrhundert werden in den historischen Überlieferungen nahezu ausschließlich schwarze Schafe auf Ouessant erwähnt. Eine Ausnahme stellt ein Beleg für ein weißes Schaf im Jahr 1861 dar. Erst ab dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts sind in der historischen Überlieferung neben den schwarzen dann auch regelmäßig kleine weiße Schafe auf der Insel nachweisbar. Es sind also zwei Farbschläge historisch belegt, ein schwarzer, der damals wie heute häufig dazu neigte, im Laufe des Jahres in schwarzbraune Farbtöne auszubleichen sowie ein weißer. Der Nutzung der schwarzen Wolle kam auf der Insel eine sehr hohe Bedeutung zu. Sie wurde zur Produktion eines robusten Stoffes für die Alltagskleidung der Frauen gebraucht. Hier ist in erster Linie ein schweres Wollgewebe mit Kettfäden aus Leinen zu nennen, das zur Herstellung sehr langer und robuster Röcke verwendet wurde. Zudem ist Wolle zum Stricken von Holzschuhsocken und als Matratzenfüllung genutzt worden. Wollüberschüsse wurden auf dem Festland verkauft. Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts Importe industriell gefertigter Stoffe auch zunehmend die Insel erreichten verlor die Eigenproduktion von schwarzer Wolle mehr und mehr an Bedeutung. Die Zahl der schwarzen Schafe war nun, photographischen Dokumenten zufolge, gegenüber den Ouessants mit weißem Flies stark rückläufig. Natürlich wurde auf der Insel auch das Fleisch der Schafe verzehrt. Aufgrund seines salzigen Aromas hatte es einen sehr guten Ruf. Daher konnten jährlich Hunderte der kleinen Schafe auf dem Festland verkauft werden. Die Ouessants galten als klein, aber als sehr wohlschmeckend.
Mitte des 19. Jahrhunderts befanden sich im Schnitt 6000 Schafe auf Ouessant. Eine Stallhaltung war unbekannt. Die Schafe beweideten nach der Ernte, ab Ende September, den Winter über freilaufend den Großteil der gesamten Insel. Im Frühjahr war dann mit dem Ende des Winterhalbjahres die Zeit der Weidefreiheit vorbei. Die Schafe wurden nun von den Inselbewohnern zusammengetrieben und auf ihre jeweiligen Besitzer verteilt, um während der Wachstumsperiode der Feldfrüchte, paarweise an Pflöcken angebunden, gehalten zu werden. Diese sommerliche Anbindehaltung geschah auf kargen Grasflächen entlang des schmalen und windigen, oft einer salzigen Gischt ausgesetzten Küstenstreifens der Insel. Hier war kein Ackerbau möglich.
Die isolierte Lage der Insel bewahrte die Rasse lange vor „Verbesserungsversuchen“. Erst ab dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bewog die Absicht höhere Schlachtgewichte zu erzielen die Inselbewohner erstmals zu Einkreuzungen einer schwereren bretonischen Festlandsrasse und deren Kreuzungen. Diese Einflüsse führten bis zum Ende des Ersten Weltkrieges zur Überprägung und schließlich zum Verschwinden des Ouessantschafes auf seiner namensgebenden Heimatinsel.
Allerdings hatten zu diesem Zeitpunkt schon zahlreiche ursprüngliche Ouessants auf dem Festland bei bürgerlichen Züchtern, in einigen zoologischen Gärten und bei adeligen Besitzern von Landsitzen und Schlössern ein neues Zuhause gefunden. Insbesondere im verwandtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld der adeligen Familie de Goulaine wurden im bretonischen Departement Morbihan und in der benachbarten Region Pays de la Loire in den folgenden Jahrzehnten Ouessantherden unter Bedingungen gehalten, die ihre robuste Natur konservierten. Die Aufgabe der Schafe bestand darin Grünflächen auf den Wohnsitzen und Familienschlössern zu beweiden und kurzzuhalten. Das geschah in einigen Fällen bis in die siebziger Jahre.
Weitgehend basierend auf einem dieser Bestände konnte dann ab den siebziger Jahren auf der Domäne Ménez Meur, einer Einrichtung des Parc naturel régional d’Armorique, eine bis heute erfolgreiche Erhaltungszucht betrieben werden. Die 1976 gegründete GEMO (Groupement des éleveurs de moutons d’Ouessant), griff bei der Einrichtung ihrer Zuchten ebenfalls auf Ouessants aus bis dahin überlebenden Beständen zurück. Mit der Gründung des französischen Zuchtverbandes für Ouessantschafe, der GEMO, konnte die Rasse Ouessant, eine der robustesten Landschafrassen Europas, in Frankreich in ihrer Ursprünglichkeit bewahrt werden. Zum Zeitpunkt der GEMO Gründung waren im Ursprungsland dieser alten bretonischen Landschafrasse nur noch wenige hundert Exemplare zu finden. Eine 1978 veröffentlichte landesweite Zählung ergab eine Population von lediglich 128 Böcken und 380 Mutterschafen in Frankreich. Um Einflüsse möglicher Einkreuzungen auszuschalten und die rassetypischen Merkmale zu bewahren formulierte die GEMO 1981 einen offiziellen Rassestandard. Darin wurde neben anderen Festlegungen die Widerristhöhe bei ausgewachsenen Böcken (d.h. im Alter von drei Jahren) auf max. 49 cm und bei ausgewachsenen Mutterschafen auf max. 46 cm begrenzt. Dank dieser Erhaltungsmaßnahmen lebten 1997 auf dem französischen Festland wieder ca. 3000 Ouessants.
Die wachsende Popularität der Ouessantsschafe über die französischen Grenzen hinaus führte zur Gründung weiterer Zuchtverbände in einigen europäischen Nachbarländern, so auch in den Niederlanden, in Deutschland und Belgien. In den Niederlanden und in der stark niederländisch beeinflussten Ouessantzucht Deutschlands wurden jedoch neben den historisch überlieferten Farben schwarz und weiß schnell Fliesfarben beliebt, die erst durch moderne Einkreuzungen entstanden sind. So führte die Einkreuzung von Romanov und Finnschafen in den Niederlanden zu einem neuen, als Schimmel bezeichneten Farbschlag. Auch der karamellbraune Farbschlag, der in den Niederlanden, in Deutschland und in Belgien schlicht als braun bezeichnet wird, dürfte das Ergebnis von Einkreuzungen sein. Er trat erstmals in den 1970er Jahren in Lille auf, nachdem ein dort ansässiger Züchter Ouessants zweifelhaften Ursprungs von einem Wanderzirkus dazu gekauft hatte. Lille liegt nahe des belgisch-französischen Grenzgebietes. Das ist mehr als 500 km vom bretonischen Ursprungsgebiet der Rasse entfernt, in dem diese moderne karamellbraune Farbvariante unbekannt war und auch historisch nicht nachweisbar ist.
Die neuen Fliesfarben, schimmel und karamellbraun, wurden in den Niederlanden und somit auch in Deutschland bedenkenlos in den Herdbüchern akzeptiert. Darüber hinaus ist das Auftreten von so genannten Glöckchen an der Kehle der Schafe ein Merkmal, das der offizielle französische Standard verbindlich ausschließt. Glöckchen finden sich heute jedoch in zahlreichen deutschen Herdbuchbeständen. Aus Belgien und den Niederlanden fanden in den letzten Jahren vermehrt Ouessants mit diesen modernen Fliesfarben Einzug auch in manche französische Bestände so dass hier aktuell ebenfalls eine rasche Verbreitung fremder Genetik zu beobachten ist.
Der Einfluss fremder Genetik und die Akzeptanz moderner Fliesfarben sind Umstände, die heute bei manchen Züchtern in Frankreich genauso wie in Deutschland Anlass geben, sich erneut um den Erhalt des originalen Ouessantschafes zu sorgen. Bis zum Jahresbeginn 2019 wurden in Deutschland lediglich 19 Böcke und 34 weibliche Ouessants in der Liste der Arbeitsgemeinschaft Erhaltungszucht bretonisches Ouessantschaf geführt, die in ihren Stammbäumen von den modernen Einflüssen gänzlich unbetroffen sind bzw. genetisch unverändert auf die Gründerherden aus der Anfangszeit der GEMO zurückgehen. Das waren höchstens 8% des deutschen Herdbuchbestandes. Um den Erhalt und den Ausbau dieser sehr ursprünglichen Satellitenpopulation in Deutschland und ihres genetischen Potentials bemüht sich die Arbeitsgemeinschaft Erhaltungszucht bretonisches Ouessantschaf. Dies geschieht in engem Kontakt mit gleichgesinnten französischen Züchtern.
Autor: Jürgen Schneider
Literatur:
Abbé, Paul. Conservation de la race ovine d‘Ouessant, in: Ethnozootechnie, 1978, 21-22.
De Beaulieu, Francois; Ronné, Hervé. Le mouton d‘Ouessant, 2015.
Dobler, Gregor. Bedürfnisse und der Umgang mit Dingen. Eine historische Ethnographie der Ile d‘Ouessant, Bretagne, 1800-2000, 2004.

Abb. 1: Diese seltene historische Aufnahme des Fotografen Henri Ladrey entstand spätestens 1915. Sie zeigt eine Gruppe schwarzer Ouessants im Jardin zoologique d‘acclimatation, einem zoologischen Garten in Paris. (Foto: Sammlung Schneider)
Arbeitsgemeinschaft
Erhaltungszucht
bretonisches
Ouessantschaf
Kontakt
Jürgen Schneider
26931 Elsfleth
0162 6889752 (zwischen 18-19:30 Uhr)
Cornelia Meyer
21368 Dahlem Harmstorf
05851 7434
taraxacum50@gmail.com
Arne Huch
21039 Hamburg
schafzuchtelbe@icloud.com